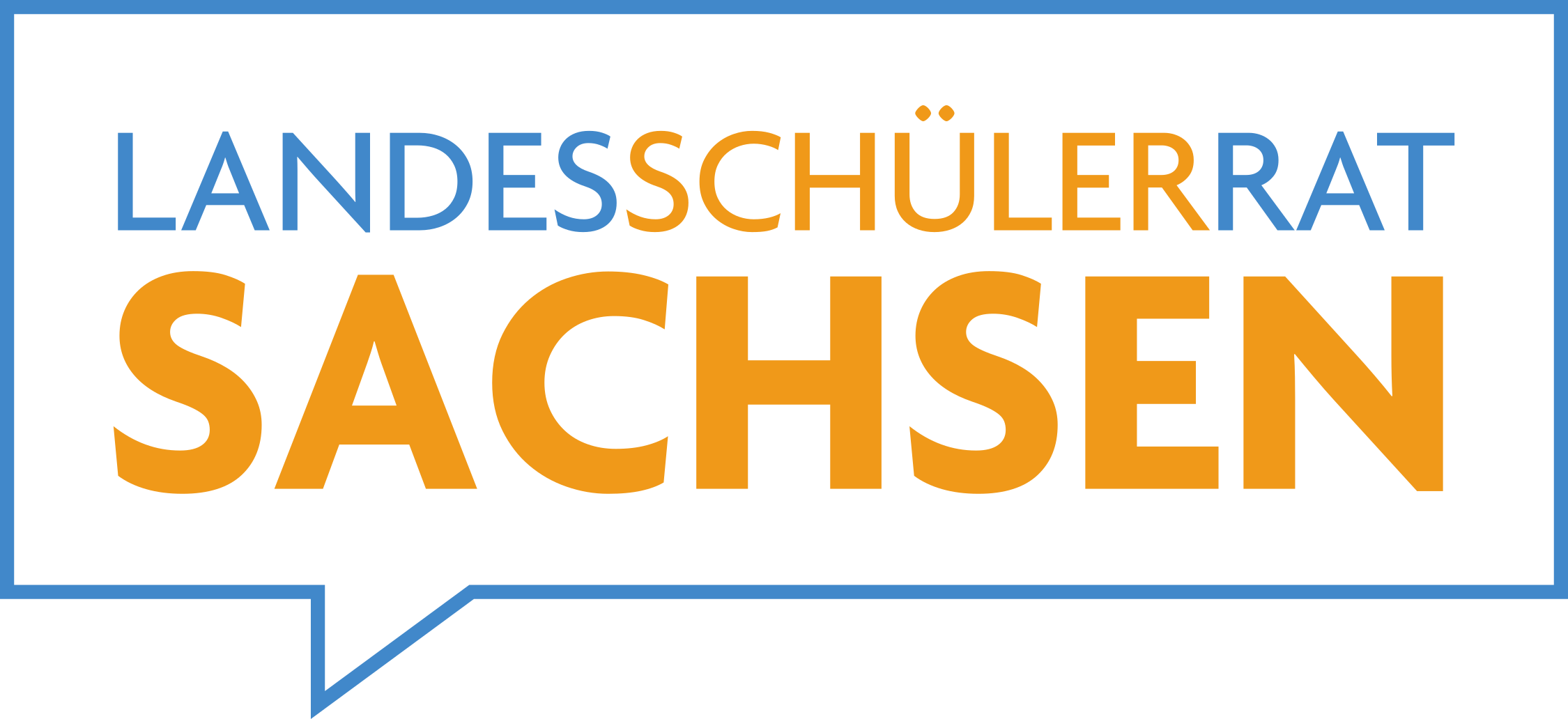Wir begrüßen grundsätzlich, dass die Problematik der Unterrichtsversorgung im Sächsischen Staatsministerium für Kultus (SMK) eine höhere Priorität erlangt hat. Die Herausforderungen sind seit Langem bekannt und auch aus unserer Sicht bedarf es dringender Veränderungen, um der aktuellen Situation Abhilfe zu schaffen. Das vom SMK vorgestellte Maßnahmenpapier ‚Maßnahmen zur Verbesserung der Unterrichtsversorgung beginnend mit dem Schuljahr 2025/26‘ muss jedoch kritisch betrachtet werden. Viele der vorgeschlagenen Maßnahmen behandeln lediglich kurzfristig die Symptome des Lehrkräftemangels und nicht die Ursachen der Problematik.
»Wir Schüler*innen sehen täglich zwei Extreme. Zum einen sind unsere Vertretungspläne endlos lang und vor allem der Ausfall hat ein Ausmaß angenommen, das schon lange nicht mehr tragbar ist. Auf der anderen Seite sehen wir, wie unsere Lehrkräfte zunehmend ausgelaugt und überlastet sind«, erklärt unsere Vorsitzende Amy.
Dabei handelt es sich um ein grundsätzliches Problem unseres Bildungssystems, das an einzelnen Schulformen zunehmend stärker ausgeprägt ist. Der Ursprung dieser Problematik liegt offensichtlich darin, dass es dem SMK nicht gelingt, den Lehrkräfteberuf so attraktiv zu gestalten, dass ausreichend Personen sich für diesen entscheiden.
Wir sprechen uns dafür aus, dass an dem Grundproblem des aktuellen Zustandes der Unterrichtsversorgung gearbeitet wird: »Um die Unterrichtsversorgung nachhaltig sicherzustellen, braucht es langfristige Lösungen. Diese müssen den Lehrkräfteberuf attraktiver machen und gleichzeitig den Druck auf Lehrkräfte sowie auf Schüler*innen verringern. Nur so kann eine tatsächliche Verbesserung erreicht werden. Kurzfristige Maßnahmen verschieben die Probleme lediglich in die Zukunft«, so Amy.
Das vorliegende Maßnahmenpapier des SMK sieht aus unserer Sicht vordergründig Erhöhungen in der Arbeitsbelastung von Lehrkräften vor. Weniger Anrechnungsstunden, neue Unterrichtsmethoden und schlechtere Integration schaffen dabei nur neue Probleme. Die Qualität von Bildung muss immer die oberste Priorität im SMK sein. Wenn die einzelne Lehrkraft mehr unterrichten und damit leisten soll, als sie ohnehin schon erbringt, geht das zwangsläufig mit einer niedrigeren Qualität der Bildung einher. Zudem sind diese auf Unterrichtskonzepte, wie hybriden oder digital gestütztem Lernen, kurzfristig nicht vorbereitet.
»Die Maßnahmen betreffen nicht nur die Lehrkräfte. Die Qualität der Bildung, die von den Lehrkräften abhängig ist, sehen wir Schüler*innen in der Praxis und sind dementsprechend auch die Verlierer*innen von schlechten Maßnahmen. So mancher Vorschlag, wie die Reduzierung von Leistungsbewertungen, betreffen uns darüber hinaus unmittelbar. Weniger Klausuren, Klassenarbeiten und Test, heißt nicht zwangsläufig weniger Stress für uns Schüler*innen, da die verbleibenden Leistungserhebungen so noch wichtiger werden«, legt Amy dar.
Besonders kritisieren wir die geplanten Maßnahmen zur Gestaltung der Kopfnoten. Die schriftlichen Einschätzungen zu diesen sind für die Schüler*innen das einzig Sinnvolle. Bereits seit Langem fordern wir die gänzliche Abschaffung der Kopfnoten, da diese ausschließlich eine subjektive Sicht auf die Schüler*innen bieten.
Gleichzeitig sehen wir auch einige Vorschläge im Maßnahmenpapier des SMK als positiv an. Dazu zählt der Einsatz von Assistenzkräften zur Entlastung der Lehrkräfte in der Ganztagskoordination, der Ausbau multiprofessioneller Teams oder die Verknüpfung digitaler Prozesse. Diese Ansätze sind aber allein aufgrund der jetzigen Belastung der Lehrkräfte dringend erforderlich.
Grundsätzlich muss man sagen, dass die Frage der Unterrichtsversorgung so zentral ist und so viele bildungspolitische Akteur*innen betrifft, dass alle diese, die Maßnahmen zur Verbesserung der Unterrichtsversorgung mittragen müssen.
»Das vorliegende Maßnahmenpapier enthält sowohl begrüßenswerte als auch problematische Vorschläge. In der aktuellen Lage brauchen wir Lösungen, die nicht auf dem Rücken von Lehrkräften und Schüler*innen ausgetragen werden. Bildung braucht jetzt vor allem Verlässlichkeit, Zusammenarbeit und eine ehrliche, kontinuierliche Evaluation jeder einzelnen Maßnahme – vor, während und nach deren Umsetzung«, erklärt Amy abschließend.